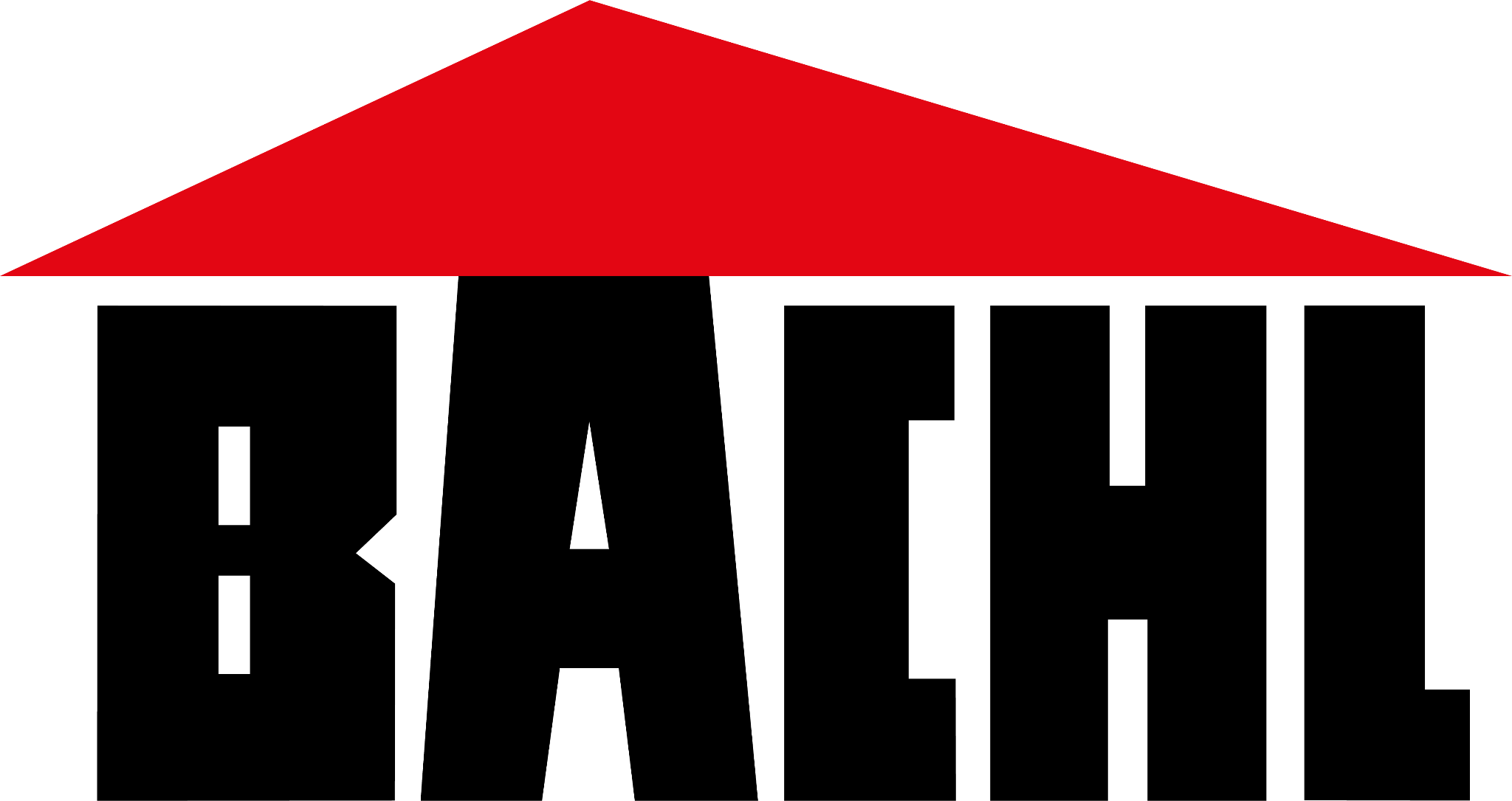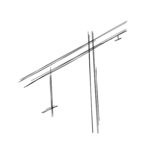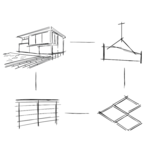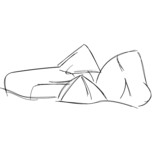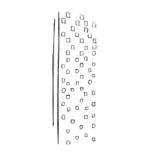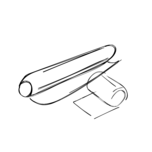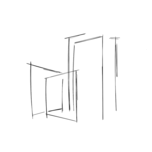deDeutsch
deDeutschUnternehmensgruppe BACHL
Auf solidem Fundament wurde die Unternehmensgruppe BACHL 1926 in Deching bei Röhrnbach im Bayerischen Wald gebaut. Heute zählt die Unternehmensgruppe zu den bedeutendsten Akteuren der Bau- und Baustoffindustrie. Rund 2 600 Mitarbeiter im In- und Ausland arbeiten täglich am Erfolg der Gruppe. Neben den deutschen Produktionsstandorten werden heute Werke und Handelsniederlassungen in Österreich, Tschechien, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien und Kroatien betrieben.
Nach anfänglicher Produktion von Mauerziegeln führte ein stetiger Aufwärtstrend zu einem erweiterten Angebot von Produkten und Dienstleistungen rund um den Bau- und Modernisierungssektor. Neben dem großen Unternehmensfeld der Dämmstoff- und Kunststoffverarbeitung, sowie den Bereichen Baustoffe, Bauelemente und Betonfertigteilproduktion, ist nach wie vor der Bausektor mit den Sparten Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Zukunftshaus sowie schlüsselfertiger Industrie- und Gewerbebau eine tragende Säule der Unternehmensgruppe BACHL.